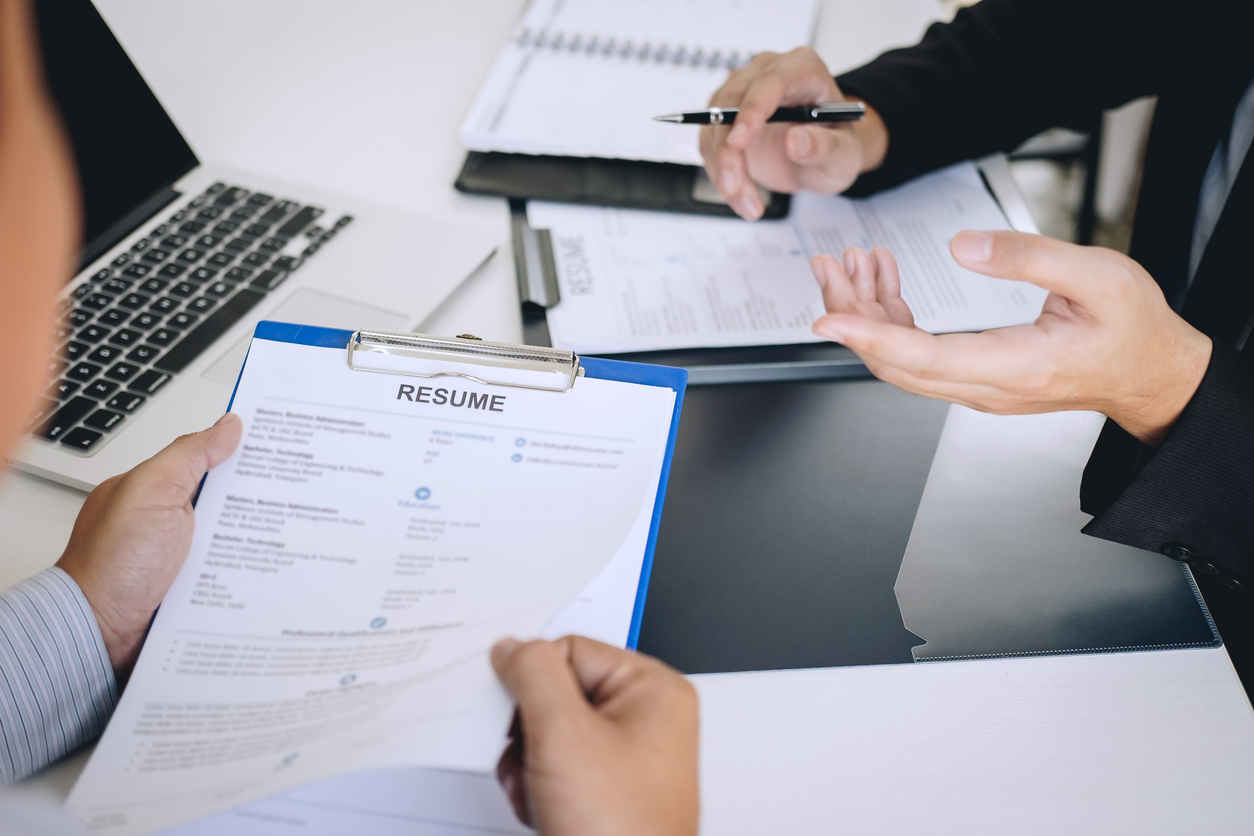Der globale Zulieferriese setzt trotz schwächelnder Fahrzeugproduktion auf digitale Steuerungstechnologien und erwartet bis 2032 Milliardenumsätze mit By-Wire-Systemen.
Wachstum gegen den Branchentrend
Während die Automobilindustrie mit stagnierenden Produktionszahlen und verzögerter Elektrifizierung kämpft, zeigt sich Bosch Mobility optimistisch. CEO Stefan Hartung prognostiziert für 2025 ein Umsatzwachstum von knapp zwei Prozent auf etwa 57 Milliarden Euro. Diese Entwicklung kontrastiert mit dem Rückgang von 0,7 Prozent im Vorjahr. Der Technologiekonzern setzt dabei auf elektronische Steuerungssysteme als Wachstumstreiber. By-Wire-Lösungen für Bremsen und Lenkung sollen bis 2032 kumuliert über sieben Milliarden Euro Umsatz generieren.
Paradigmenwechsel in der Fahrzeugentwicklung
Mobility-Chef Markus Heyn beschreibt eine fundamentale Umkehr bisheriger Entwicklungsprinzipien: "Das Design der Hardware richtet sich in Zukunft nach den Anforderungen der Software." Früher bestimmte die Hardware die Software-Architektur. Diese Transformation erfordert neue Kompetenzen. Während Bosch traditionell geschlossene Systeme aus Hardware und Software lieferte, müssen heute modulare, kompatible Lösungen entwickelt werden. Die Software muss mit verschiedenen Hardware-Komponenten funktionieren.
Strategische Allianzen nach regionalen Märkten
Bosch verfolgt unterschiedliche Kooperationsstrategien je nach Markt. In China arbeitet das Unternehmen mit WeRide und Horizon Robotics an Assistenzsystemen, während in Europa die Partnerschaft mit VW-Tochter Cariad im Fokus steht. Besonders China entwickelt sich zum Innovationstreiber. Dort demonstrierte Bosch bereits ein Fahrzeug, das autonom durch deutschen Stadtverkehr navigiert – trainiert mit chinesischen Verkehrsdaten.
Investitionen in zentrale Steuerungssoftware
Einen dreistelligen Millionenbetrag plant Bosch bis 2028 für die Weiterentwicklung seiner "Vehicle Motion Management"-Software. Diese koordiniert alle Fahrzeugbewegungen zentral und kommt bereits bei über zwei Dutzend Herstellern zum Einsatz. Das Geschäft mit Fahrzeugcomputern wächst jährlich um mehr als fünf Prozent. Zu den Kunden zählen BMW und in China SAIC-GM für KI-basierte Cockpit-Systeme.
Auswirkungen auf Professional Services
Für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer entstehen durch diese Transformation neue Mandate. Komplexe Softwarekapitalisierung, Bewertung immaterieller Wirtschaftsgüter und internationale Kooperationsstrukturen erfordern spezialisierte Beratung. Die Verschiebung von Hardware- zu Software-dominierten Geschäftsmodellen verändert auch Bilanzierungsstandards und Compliance-Anforderungen grundlegend.
Verwandte Artikel
Aktuelle Stellenangebote
Meistgelesene Artikel
Mehr Themen entdecken
Unsere Partner
Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei: