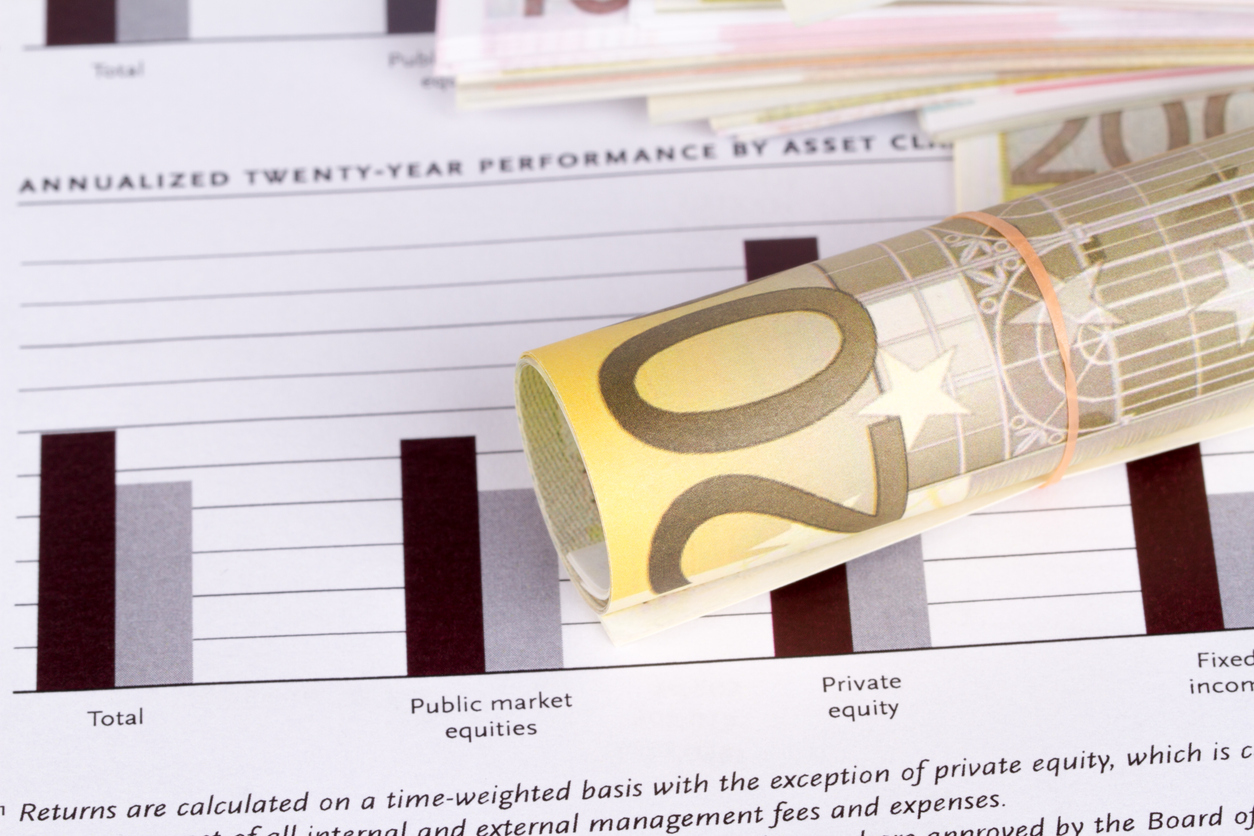Das Oberlandesgericht Köln erklärt öffentliche Social-Media-Posts zur rechtsfreien Zone für KI-Training – auch Gesundheits- und Politikdaten verlieren Schutzstatus.
DSGVO-Artikel 9 kapituliert vor Tech-Giganten
Während Bundesdatenschutzbeauftragte Louisa Specht-Riemenschneider die OLG-Eilentscheidung als „unfassbar" brandmarkt, etabliert der 15. Zivilsenat faktisch einen Freibrief für systematische Datenextraktion. Meta erhält Carte Blanche für LLaMA-Training mit sämtlichen volljährigen EU-Nutzerdaten von Facebook und Instagram. Das Gericht interpretiert die DSGVO-Ausnahme für „offensichtlich öffentlich gemachte" sensible Daten extensiv: Jeder öffentliche Social-Media-Post transformiert politische, religiöse, sexuelle oder Gesundheitsinformationen in legitime KI-Trainingsdaten. User sollen bei öffentlichen Postings mit maschineller Verwertung rechnen müssen.
Dritte werden zu kollateralen Datenschutz-Opfern
Besonders prekär: Das OLG schwächt sogar den Schutz unbeteiligter Dritter. Sensible Informationen über nicht-postende Personen unterliegen nur dann DSGVO-Artikel 9, wenn Betroffene aktiv Widerspruch einlegen – eine Aktivierungsklausel, die faktische Überwachung und Intervention voraussetzt. Der Zivilsenat signalisiert Unsicherheit und erwägt EuGH-Vorlage bei Hauptsacheverfahren. Diese juristische Kapitulation offenbart die Hilflosigkeit nationaler Gerichte gegenüber Tech-Konzern-Ambitionen.
KI-Verordnung als Datenschutz-Sargnagel
Die Richter legitimieren ihre Position durch die EU-KI-Verordnung, die Training mit „riesigen Mengen an Text, Bildern, Videos und anderen Daten" als notwendig anerkennt. Webscraping-Praktiken werden retrospektiv legalisiert, obwohl diese systematisch sensible Daten erfassen – ein regulatorischer Offenbarungseid.
Neuinterpretation datenschutzrechtlicher Grundsätze
Das Kölner Urteil (Az.: 15 UKl 2/25) signalisiert eine veränderte Gewichtung zwischen Datenschutz und technologischer Innovation. Die Richter interpretieren bestehende DSGVO-Ausnahmen zugunsten systematischer Datennutzung für KI-Entwicklung, was die Balance zwischen Privatsphäre und wirtschaftlichen Interessen neu justiert. Specht-Riemenschneiders kritische Bewertung reflektiert die datenschutzrechtliche Kontroverse um diese Auslegung. Das Urteil könnte Präzedenzcharakter entwickeln und die praktische Anwendung europäischer Datenschutzstandards bei KI-Training nachhaltig beeinflussen, wobei eine abschließende rechtliche Bewertung dem möglichen EuGH-Verfahren vorbehalten bleibt.
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Stellenangebote
Mehr Themen entdecken
Unsere Partner
Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:



Unsere Website benutzt Cookies.
Alle weiteren Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung