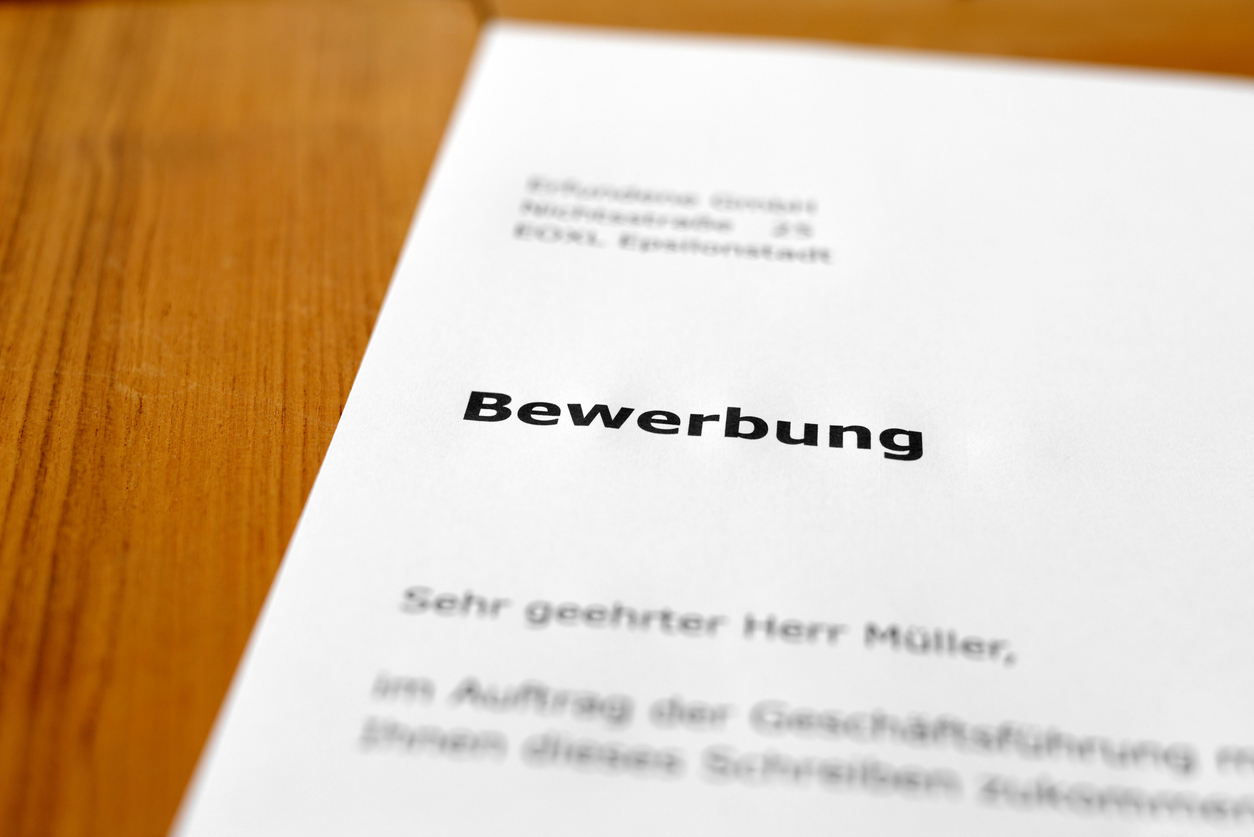Im Gegensatz zum anonymen Massenbetrieb universitärer Vorlesungen bieten AGs im Referendariat praxisnahe Examensvorbereitungen in kleinem Kreis – eine Ressource, die strategisch genutzt werden sollte.
Strukturierter Ausbildungsbaustein mit klarem Regelwerk
Die Arbeitsgemeinschaften (AGs) bilden das strukturelle Rückgrat des juristischen Referendariats. "Die Ausbildungsordnung der einzelnen Bundesländer legt genau fest, wie oft die Arbeitsgemeinschaften stattfinden und welche Inhalte sie haben", erläutert Katrin Brüggmann, Staatsanwältin und AG-Leiterin in Rostock. Je nach Bundesland variiert der Rhythmus von wöchentlichen Terminen bis zu Blocklehrgängen.
Zu Stationsbeginn steht ein ein- bis vierwöchiger Einführungslehrgang, der fundamentales Wissen zum jeweiligen Rechtsgebiet vermittelt. So erhalten die Referendare in der Strafstation Einblick in staatsanwaltschaftliche Verfügungen, in der Verwaltungsstation den Verwaltungsaufbau und in der Zivilstation Aktenkunde.
Praxisorientierte Examensvorbereitung als Kernziel
"Vorrangiges Ziel der AGs ist es, auf die schriftlichen und mündlichen Prüfungen vorzubereiten", betont Siegmar Ade, Vorsitzender Richter am LG Stuttgart und Ausbildungsleiter. Die AG-Leitungen nutzen verschiedene didaktische Konzepte: Übungsklausuren unter Echtzeit-Bedingungen, diskursive Fallbearbeitung oder die Möglichkeit, an Klausuren von Parallel-AGs teilzunehmen.
Florian Meuser, Ausbildungskoordinator für AG-Leiter der Verwaltungsstation Hessen, setzt zusätzlich auf regelmäßige Aktenvorträge: "Wenn man die Vorgänge lange genug wiederholt, gehen sie irgendwann in Fleisch und Blut über, was Prüflingen einen klaren Zeitvorsprung verschafft."
Partizipation als Schlüssel zum Lernerfolg
Die AG-Leiter erwarten aktive Beteiligung. "Ich lege großen Wert auf Beteiligung, weil man dadurch am meisten aufnimmt", unterstreicht Brüggmann. "Wenn die AG-Teilnehmer wissen, dass sie jeden Moment etwas gefragt werden können, konzentrieren sie sich mehr und driften nicht ab."
Ein entscheidender Vorteil: Die kleine Gruppengröße schafft eine vertrauensvolle Lernumgebung. "Die kleinen AG-Gruppen bleiben wie eine Schulklasse die gesamten zwei Jahre des Referendariats zusammen, das schafft Vertrauen", erläutert Cornelia Rank, Co-Ausbildungsleiterin am LG Stuttgart. Diese Konstanz fördert die Bereitschaft, Verständnisfragen zu stellen – ein fundamentaler Unterschied zu überfüllten Hörsälen.
Administrative Rahmenbedingungen
Die Teilnahme an den AGs ist obligatorisch und genießt Priorität vor allen anderen dienstlichen Verpflichtungen. Die einzige Ausnahme bilden Auslandsaufenthalte: "Wer sich in der Verwaltungsstation im Ausland aufhält, muss sich in Eigenverantwortung auf die examensrelevanten Inhalte im öffentlichen Recht vorbereiten," erklärt Meuser.
Als Bindeglied zwischen AG-Leitung und Teilnehmern fungiert der gewählte AG-Sprecher. Neben administrativen Aufgaben wie der Informationsweitergabe bei Raumänderungen kommuniziert er auch Anliegen und Verbesserungsvorschläge der Gruppe an die Leitung.
Das Fazit der AG-Leiterin Brüggmann verdeutlicht den interdependenten Charakter der Arbeitsgemeinschaften: "Jeder soll etwas beitragen, aber auch etwas aus den AGs mitnehmen." Diese Wechselwirkung kann bei strategischer Nutzung zum entscheidenden Erfolgsfaktor für das Zweite Staatsexamen werden.
Verwandte Artikel
Aktuelle Stellenangebote
Meistgelesene Artikel
Mehr Themen entdecken
Unsere Partner
Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei:


Entdecken Sie mit uns bundesweit exklusive Stellen bei: